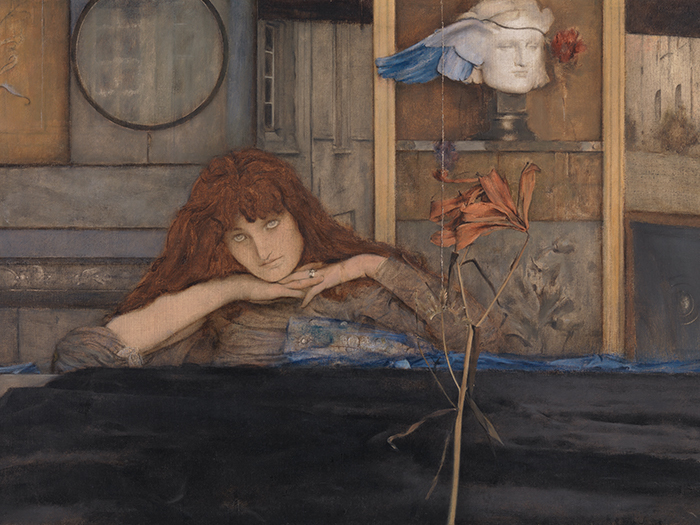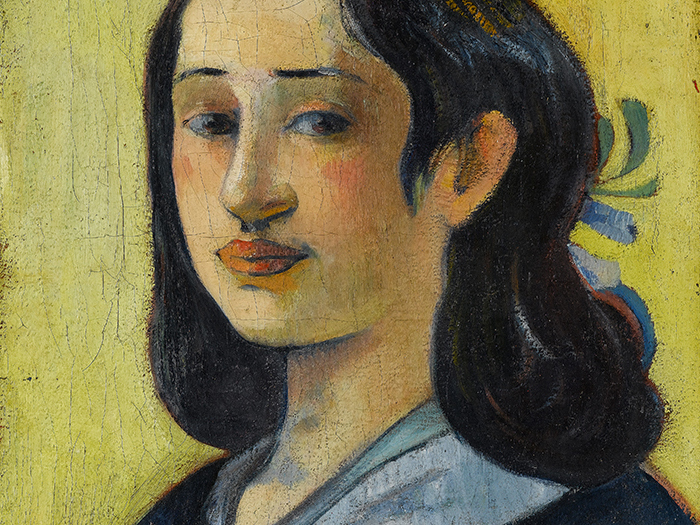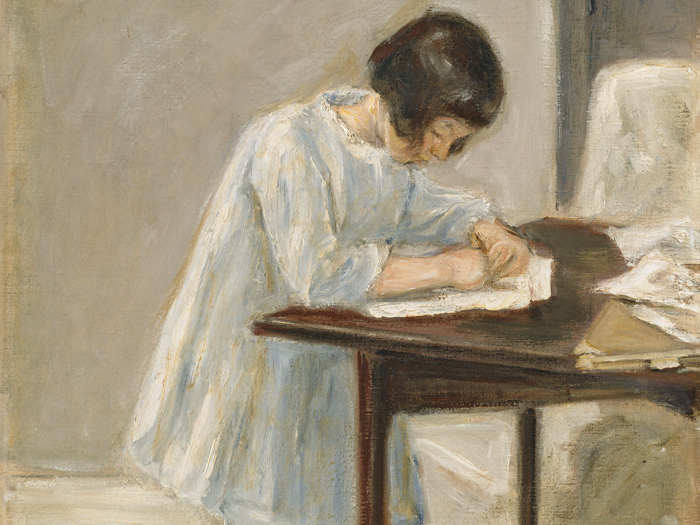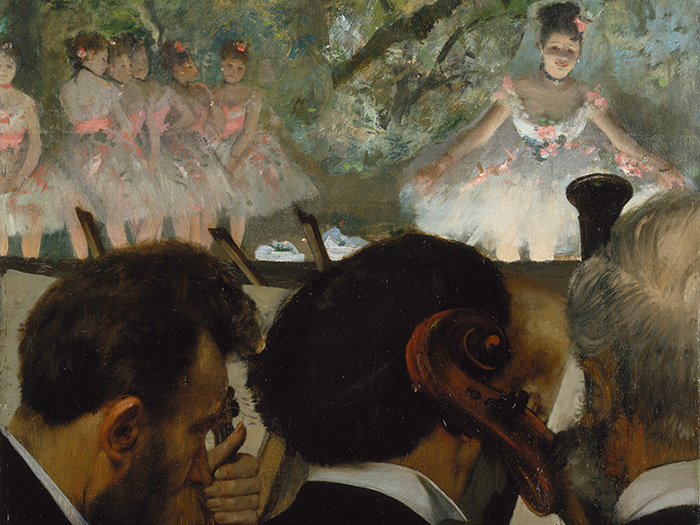Öl auf Leinwand
135 x 232 cm
© Foto: Alte Nationalgalerie / Andres Kilger
Flachsscheuer in Laren, 1887
Arbeit für Frauen und: Kinder
In der niedrigen, aber weitläufigen und hellen Scheune sind alle Anwesenden mit derselben Arbeit, dem Flachsspinnen, beschäftigt. Liebermann schildert einen Schritt im Prozess der Leinenherstellung, der im Holland des ausgehenden 19. Jahrhunderts weitgehend mechanisiert ist. Das Verspinnen der langen Flachsfasern zu Fäden konnte jedoch nur in Handarbeit erledigt werden. Kinder drehen die in langer Reihe am Fenster aufgestellten Schwungräder der Spindeln. Frauen und Mädchen stehen verteilt im Raum, ein Flachsbündel unter dem Arm, formen sie in ihren Händen den Faden.
Flachsscheuer in Laren, 1887
Stille Konzentration
Max Liebermann schildert die Gleichförmigkeit dieses Arbeitsvorgangs realistisch und nahezu feierlich. Licht und Glanz fallen von links durch die hohen Fenster auf die schlichte Szene, die von Ruhe und Beständigkeit geprägt ist. Es scheint eine stille Konzentration zu herrschen. Alle Personen unterliegen demselben Arbeitstakt, sie sind an das Rad oder den Faden, an ihre Funktion im Prozess der Arbeit gebunden.
Flachsscheuer in Laren, 1887
Farben und Licht
Die gleichförmigen, sich ständig wiederholenden Bewegungen der spinnenden Frauen nimmt auch die Farbgebung auf: ihr fehlen dramatische Kontraste, vielmehr ist sie zurückhaltend und kühl. Ein helles, silbrig graues Licht, wie es Liebermann in Holland so liebt, umfängt die Szene. Überhaupt ist es das Licht, das hier in vielfältigen Reflexen das Leben und die Schönheit betont – eine Alltagspoesie von gelassenem Klang.
Flachsscheuer in Laren, 1887
Anregungen aus Holland
Für Liebermann und seine Künstlerfreunde ist Holland zu dieser Zeit ein wichtiges Reiseziel. In Rembrandt und Frans Hals finden sie ihre künstlerischen Vorbilder und in der Arbeit vor dem Motiv eine Möglichkeit, sich von der traditionellen Ateliermalerei zu befreien. Zudem sehen sie dort das Ideal von bürgerlichem Gemeinschaftssinn und einem festen sozialen Gefüge verwirklicht.
Flachsscheuer in Laren, 1887
Unverletzliche Würde
Aus den Gesichtern der Arbeiterinnen spricht weniger die Härte ihres Alltags, sondern ruhige Gewissheit und auch eine unverletzliche Würde. Dies verleiht dem Bild ein Pathos, das bis dahin der Historienmalerei vorbehalten ist. Für das Bürgertum der Gründerzeit ist eine so erhabene Darstellung der Arbeit zwar nicht mehr fremd, aber doch provozierend.
Flachsscheuer in Laren, 1887
Ein neuer Realismus
Mit der „Flachsscheuer in Laren“ positioniert sich der junge Liebermann als progressiver Vertreter eines neuen, sozialen Realismus. Er macht das Gemälde der Nationalgalerie zum Geschenk, um die konservativ-kritische Ankaufskommission zu umgehen und im verkrusteten Berliner Kunstleben Beachtung zu finden. Trotzdem gilt das Werk als angekauft, weil für den geringen Betrag von 500 Mark einige Vorstudien erworben werden. Ein wichtiger Prestigegewinn für einen jungen Künstler! Es ist das erste Bild Liebermanns, das in einem Museum ausgestellt wird.