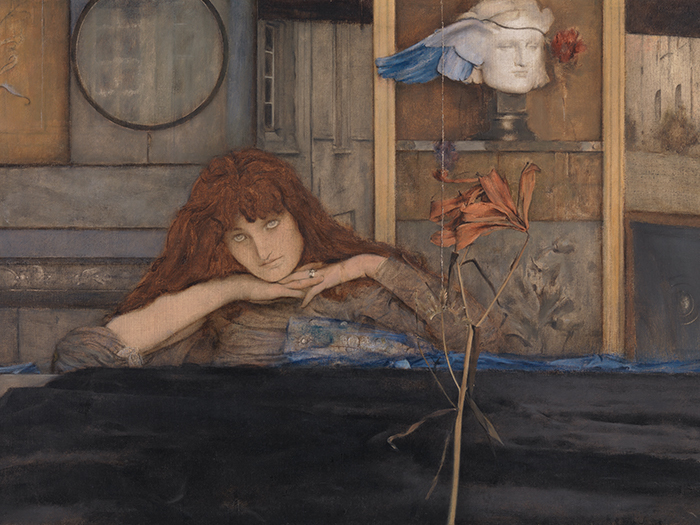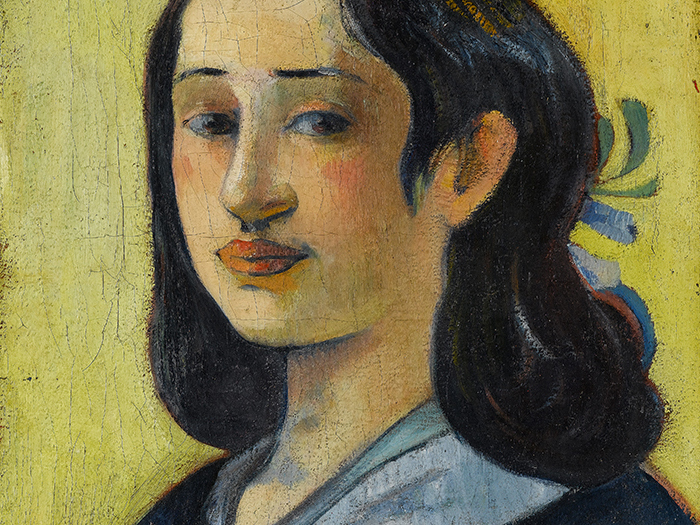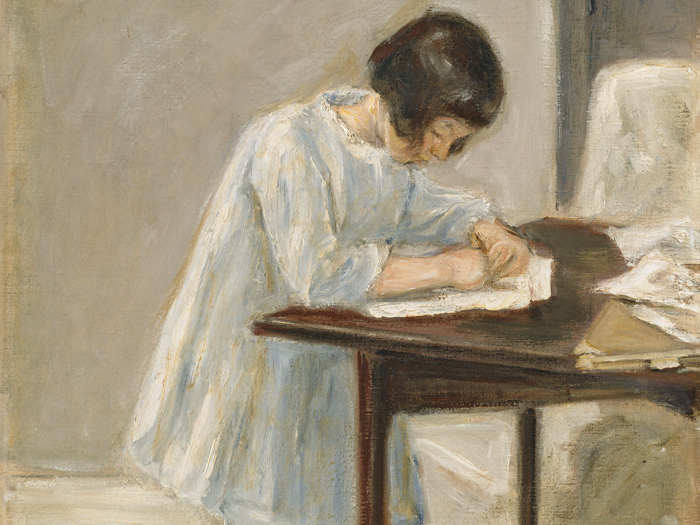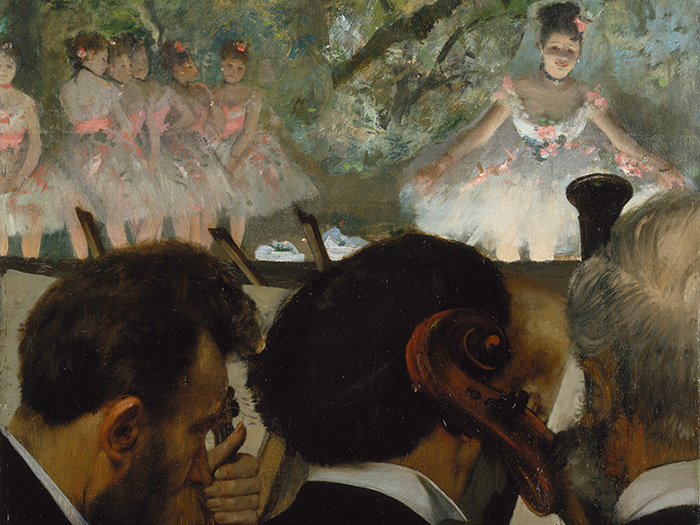Öl auf Leinwand
102,8 x 147,7 cm
© Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Neue Pinakothek München / Foto: Nicole Wilhelms
Ideale Ansicht der Akropolis und des Areopag in Athen, 1846
Vom Burgberg zum Tempelbezirk
Die Akropolis war in vorklassischer Zeit der Burgberg Athens. Nach den Zerstörungen der Perserkriege im 5. Jahrhundert v. Chr. wurde das Felsplateau als Tempelbezirk neu bebaut. Seither standen dort die Tempel wichtiger Gottheiten.
Ideale Ansicht der Akropolis und des Areopag in Athen, 1846
Griechische Siegesgöttin und römischer Feldherr
Eine breite Treppe führt zu den Propyläen hinauf. Der kleine Tempel rechts von der Treppe ist der Siegesgöttin Nike geweiht. Links davon auf einem hohen Sockel steht das Denkmal des römischen Feldherrn Agrippa. Das Gemälde bezieht sich auf die Zeit, als Athen und Griechenland ein Teil des römischen Imperiums waren.
Ideale Ansicht der Akropolis und des Areopag in Athen, 1846
Athena als monumentale Bronzefigur
Der Torbau des Tempelbezirkes, die sogenannten Propyläen, wird überragt von der monumentalen Bronzefigur der Athena Promachos: mit Schild, Helm und Speer bewaffnet verteidigt sie die Stadt Athen.
Ideale Ansicht der Akropolis und des Areopag in Athen, 1846
Architekt und Bildhauer Phidias
Der größte und bedeutendste Tempel auf der Akropolis ist der Parthenon. Er war der Stadtgöttin Athena geweiht. Der Bildhauer Phidias hat den Bau entworfen und die Skulpturen an den beiden Giebeln geschaffen. Im Inneren befand sich die aus Gold und Elfenbein gefertigte Statue der Göttin, die ebenfalls von Phidias stammte und in der Antike das am meisten bewunderte Bildwerk war.
Ideale Ansicht der Akropolis und des Areopag in Athen, 1846
Das Treiben in der Agora
Der Maler zeigt aber nicht nur die Akropolis, sondern auch einen weiten Platz im Vordergrund: die Agora, Versammlungs- und Marktplatz des antiken Athens. Auf dem Platz hat sich eine Menschenmenge versammelt. Sie hört einem Redner zu, der auf den Stufen steht.
Ideale Ansicht der Akropolis und des Areopag in Athen, 1846
Christentum als Fortsetzung der antik-griechischen Religion
Der Redner auf dem Vorplatz ist der Apostel Paulus. Er predigte im Jahr 54 n. Chr. auf dem Areopag zu den Athenern und vermittelte ihnen seine Überzeugung, das Christentum sei die Fortsetzung der antik-griechischen Religion. Auch Leo von Klenze vertrat diese Auffassung. Für den Maler und Architekten beruhte die neuzeitliche Kunst auf der Antike, so wie das Christentum die griechische Philosophie in sich aufgenommen hat. Dieser Überzeugung verleiht er in seinem programmatisch zu verstehenden Gemälde Ausdruck.
Ideale Ansicht der Akropolis und des Areopag in Athen, 1846
Ideale eines Architekten
Als Architekt des 19. Jahrhunderts baute Leo von Klenze keine Tempel, sondern Schlösser, Denkmäler, Kirchen und Museen – nicht zuletzt die Alte Pinakothek in München.